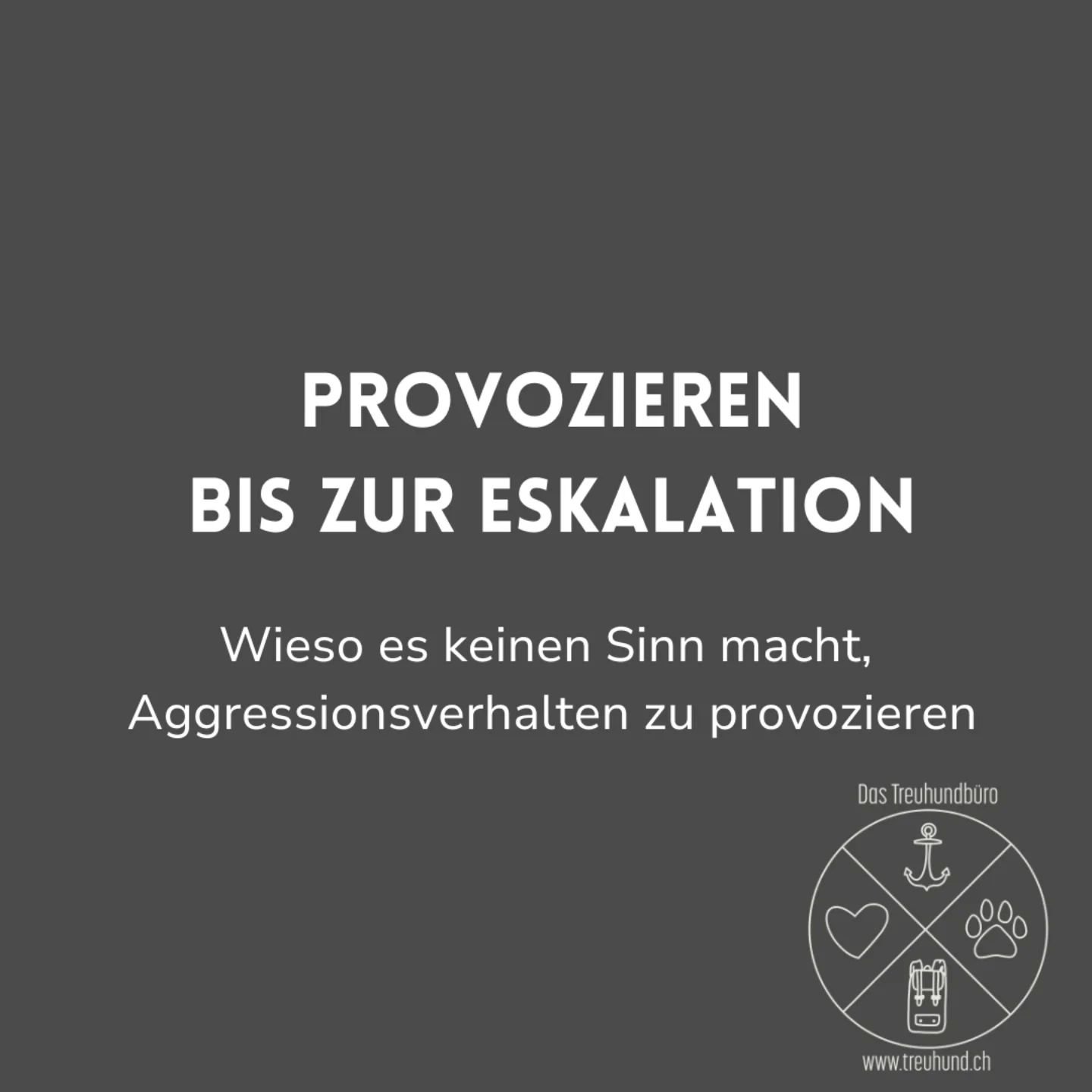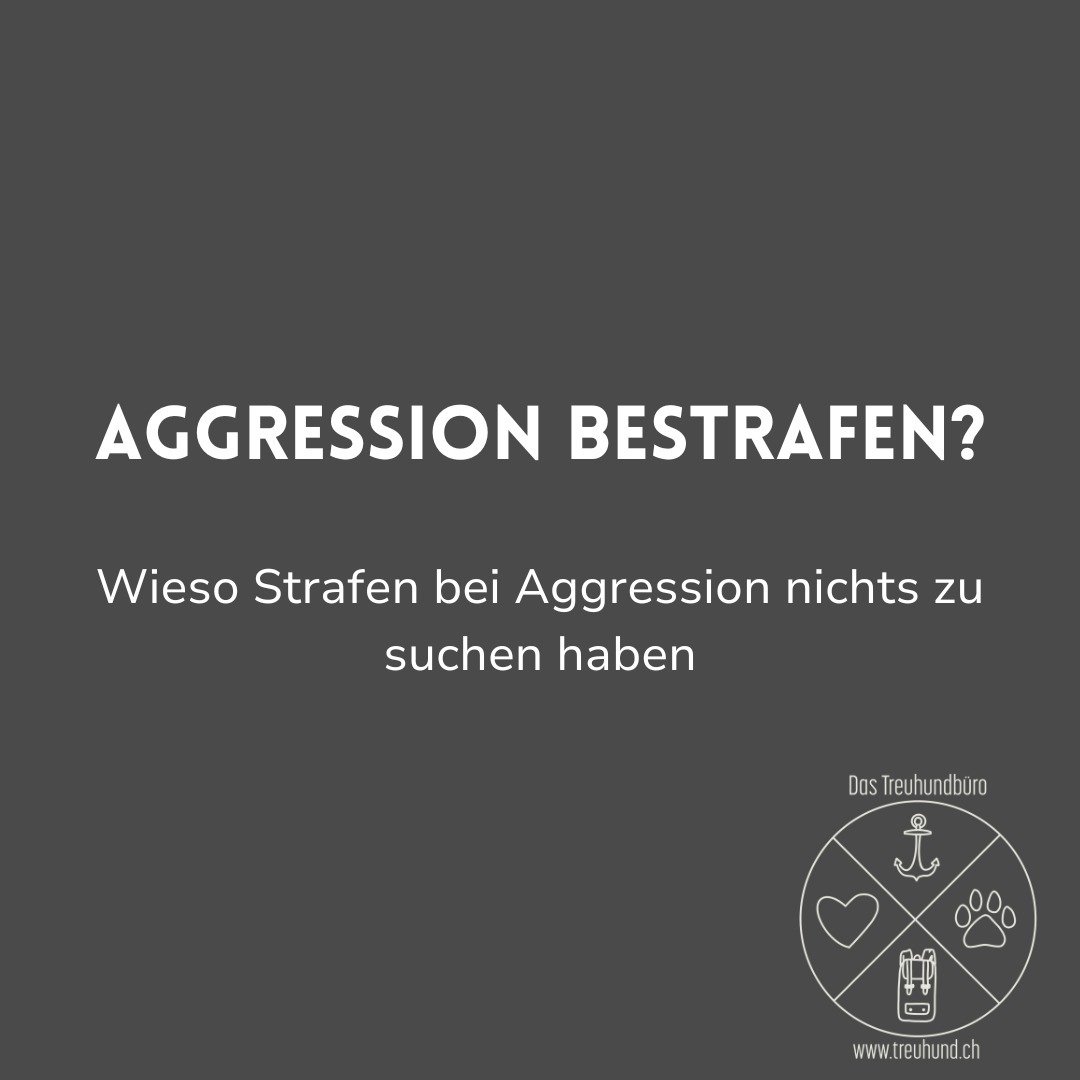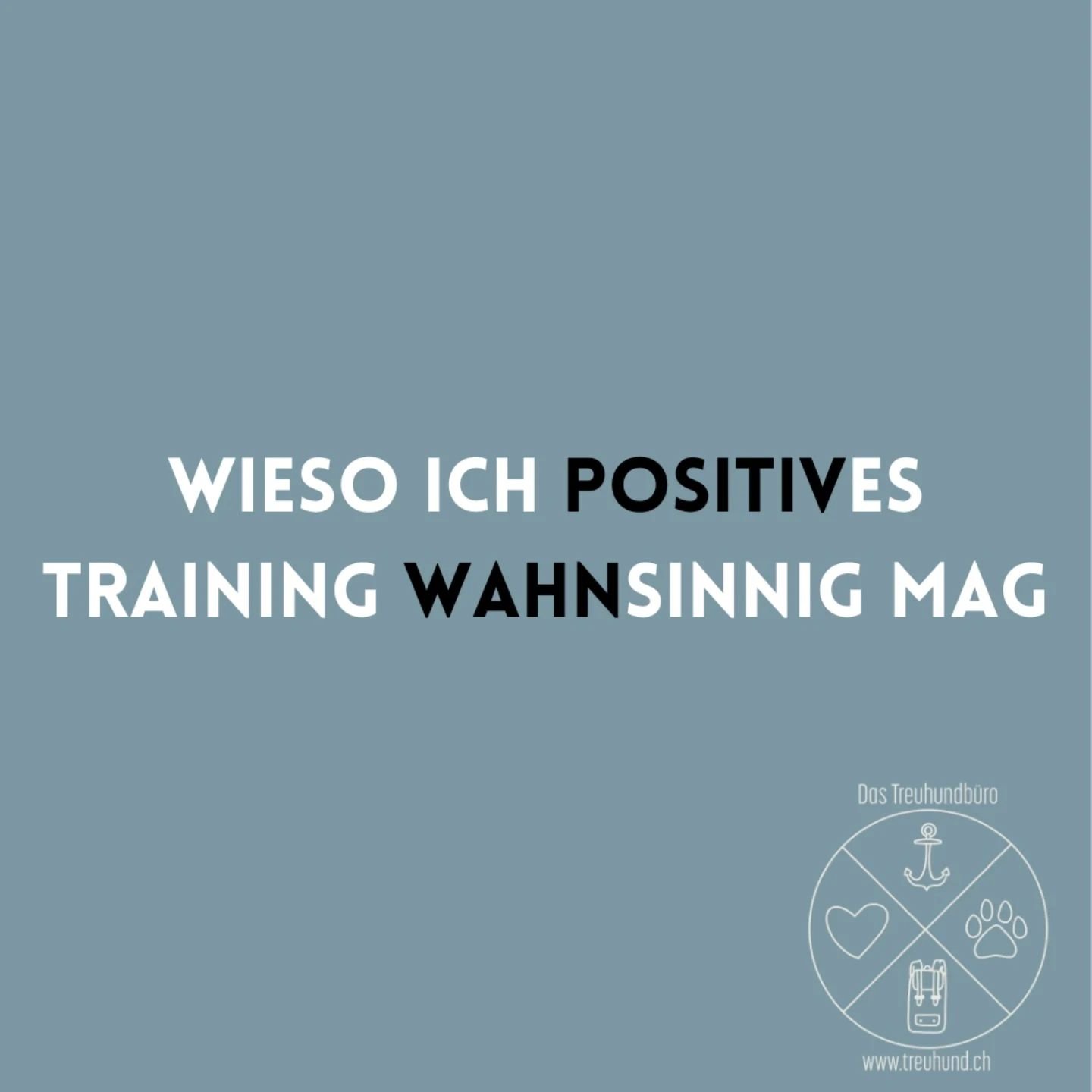Instagram-Beiträge Amanda

Wie sollen wir denn nun Hunde, die gelernt haben zu beissen, trainieren? Here is how! ➡️
Logan bekommt eine zweite Chance. Er wird zu Menschen vermittelt, die eine positiv arbeitende Trainerin an ihrer Seite haben. Die Menschen wissen, dass die Gefahr besteht, dass Logan schnell eskaliert, weil er bisher nur mit diesem Verhalten Erfolg hatte. Oberstes Ziel ist daher, dass Logan wieder lernen darf, dass seine Kommunikation gesehen und verstanden wird. Die Menschen beobachten deshalb die Körpersprache von Logan sehr genau und legen viel Wert darauf, beengende und bedrohende Situationen komplett zu vermeiden. «Better safe than sorry!», sagen sie.🖤
Gleichzeitig wird Vertrauen aufgebaut: Die Menschen achten auf einen routinierten Tagesablauf und bieten Logan viele spassige gemeinsame Aktivitäten an wie Spiel und Training mit positiver Verstärkung. Bald entdecken die Menschen Logans Freude am Dummytraining. «Es macht so viel Spass mit ihm! Er macht das so toll.», heisst es.🥰 Gemeinsame Erfolgserlebnisse verbinden und fördern Vertrauen. 🖤
Auf Nähe aber auch Distanz achten die Menschen sehr sorgfältig. Logan darf bei ihnen sein, wenn er das möchte, er bekommt aber auch eine eigene Sicherheitszone, in der er in Ruhe gelassen wird. «Es ist so schön, wenn er von sich aus unsere Nähe sucht!», erzählen die Menschen nach einigen Wochen.🖤
Logan bekommt viel Ruhe und Schlaf, denn ein ausgeschlafener Hund ist toleranter und weniger ängstlich. Er lernt, dass er sich auf seine Menschen verlassen kann, dass sie sich für seine Bedürfnisse einsetzen und seine Grenzen respektieren.🖤
Um die Sicherheit auch später in vielleicht unvermeidbaren, brenzligen Situationen wie z.B. beim Tierarzt zu gewährleisten, lernt Logan einen perfekt sitzenden Maulkorb zu tragen. Denn es kann sein, dass er unter Stress trotz all der Bemühungen in alte Muster zurückfällt. «Trotzdem ist er ein ganz toller Hund.» heisst es.🖤
Jeder Hund ist toll. Und jeder Hund hat das Potenzial, zu beissen, wenn ihm nichts anderes übrigbleibt. Aber jeder Hund hat die Chance verdient zu lernen, dass seine Grenzen respektiert werden.🖤
Gewalt erzeugt Gewalt, Druck erzeugt Gegendruck. Simple as that... 🖤

«Sie hat gelernt, ihre Zähne einzusetzen.» ist ein Satz im Vermittlungstext einer Hündin, die im Tierheim durch gewaltvolles Training therapiert werden sollte. Hüpfe dazu gerne in die vorigen beiden Posts! ➡️ Nun werfen wir einen Blick darauf, was ein Hund eigentlich lernt, wenn er beisst:
Unser Beispielhund heisst Logan. Er kommt als Welpe in eine Familie. Die Menschen nehmen leider die feinen Signale von Logan nicht wahr, wenn er sich bedroht oder unwohl fühlt. Er legt die Ohren zurück, wendet den Blick ab, wedelt wie wild mit dem Schwanz. «Ach wie süss!», heisst es. Kinder setzen sich zu Logan ins Bettchen und er bleibt wie angewurzelt liegen. «Er mag das voll.», heisst es. Logan bleibt nichts anderes übrig, als deutlicher zu kommunizieren: Er beginnt zu knurren. «Böser Hund!», heisst es. Eine aversive Hundeschule rät, Logan in diesem Fall mit Wasser zu bespritzen. Er muss lernen, dass er das auszuhalten hat und zuunterst in der Rangordnung steht. Und dann, irgendwann, hat Logan die Schnauze voll - wortwörtlich. «Ganz plötzlich hat er einfach gebissen!», heisst es. «Er muss sofort weg. Egal wohin, aber hier kann er nicht bleiben.» Und so landet er im Tierheim. 💔
Was hat Logan gelernt? Feines Meideverhalten und auch deutliches Knurren als Drohung hat nie funktioniert: Das Verhalten wurde nicht verstärkt. Im Gegenteil. Trotz des Verhaltens hat die unangenehme Situation angedauert oder durch Strafe noch schlimmer. Das Verhalten ist nicht erfolgreich und wird deshalb in Zukunft weniger gezeigt. Irgendwann eskaliert die Situation und der Hund beisst zu. 💥 Und hat damit Erfolg! Alle gehen ihm aus dem Weg – Ziel erreicht. Das Verhalten wird in Zukunft mehr gezeigt. Und die künftigen Menschen haben ein Problem: denn da Logan das Meide- und Drohverhalten, das eigentlich dem Aggressionsverhalten vorgelagert ist, nicht mehr oder viel weniger lange zeigt, wird es vielviel schwieriger, zu erkennen, wenn sich Logan bedroht, eingeengt oder verängstigt fühlt. Viel schneller setzt er direkt seine Zähne ein. Weil er gelernt hat, dass es das Einzige ist, was hilft.
Aber wenn man Logan jetzt nicht strafen soll, was dann? Mehr dazu im nächsten Post!🖤
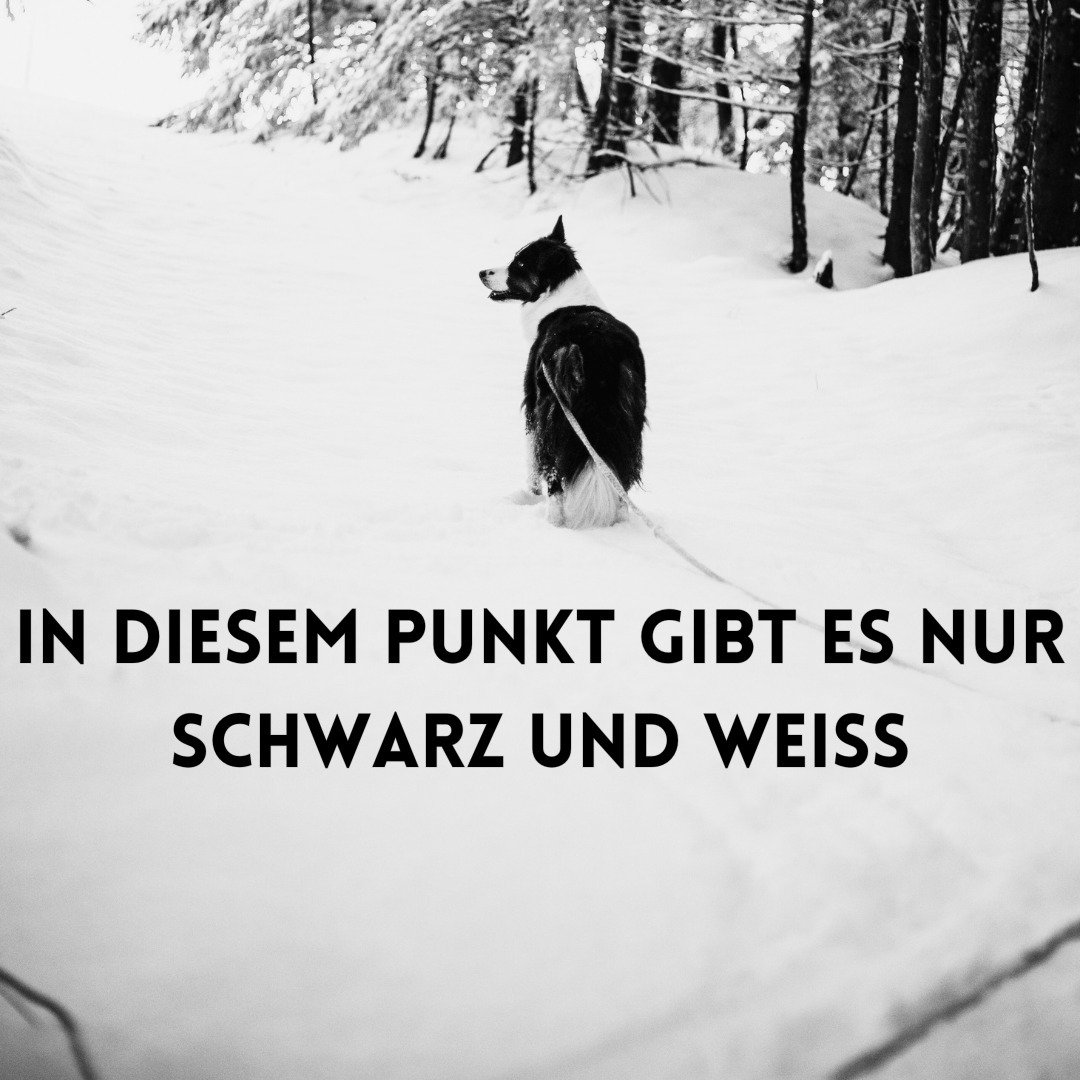
Immer wieder lese ich: "Immer dieses Schwarz-Weiss-Denken! So einfach ist es halt nicht..." Blabla Bullshit! Jetzt mal Klartext: Doch. Für mich ist es IN DIESEM PUNKT so einfach. Gewalt hat im Umgang mit unseren Hunden nichts verloren. PUNKT. Es ist so einfach. Blocken und Anschreien ist genauso Gewalt, wie eine Giesskanne werfen, auf den Hund oder auch daneben, wie den Hund treten oder schlagen. Trainingsdiscs und mit Wasser abspritzen sind genauso Gewalt wie der Würger. Eine Retrieverleine gehört an keinen Hund, auch wenn man sie überall kaufen kann. Alles, was dem Hund weh tut oder Angst macht, IST Gewalt. Und nein. Kein Verhalten eines Hundes rechtfertigt Gewalt. Ich kann durchaus verstehen, dass man an seine Grenzen stösst mit einem reaktiven Hund. Denn ja, I've been there! Aber dann sind es MEINE Grenzen. Und es ist MEINE Aufgabe, dafür zu sorgen, meinen Horizont zu erweitern, indem ich mir Wissen aneigne, mir Hilfe hole, wie ich diese Situation mit meinem Hund bewältigen kann. Und zwar ohne Gewalt. Hier liegt aber das Problem! So viele Leute propagieren Gewalt am Hund. Teilweise offen und transparent. Teilweise versteckt hinter: «Hier lernst du ohne Bestechung durch Kommunikation auf Augenhöhe zu trainieren». Und es sieht so einfach aus! Der Hund ist im null komma nichts leise und brav. Ein Träumchen. Nach nur einer Trainingseinheit sind alle Probleme gelöst. Und hier sind wir an dem Punkt, an dem es nicht so einfach ist! Denn der gewaltfreie Weg ist alles andere als einfach. Es braucht viel Wissen und Verständnis für den Hund. Dieser Weg kann Einschränkungen für mich in meinem Alltag bedeuten. Er kann mich übelst herausfordern. Das Verhalten meines Hundes kann mich triggern, wütend und verzweifelt machen. Hier sehe ich das: "So einfach ist das nicht..." Der Alltag mit einem (reaktiven) Hund ist super schwer. Aber die Entscheidung für den gewaltfreien Weg ist für mich verdammt einfach. Es gibt kein "Ein bisschen Gewalt ist ok." Für mich gibt es in diesem Punkt nur Schwarz und Weiss.

Lass uns mal ein Gedankenexperiment machen:
Du bist seit über 30 Jahren (über ein Drittel deiner Lebenserwartung) in einem sogenannten Resozialisierungsprojekt. Du wirst dort festgehalten und hast kein Mitbestimmungsrecht. Du hast ein Zimmer für dich allein, wo du die meiste Zeit des Tages eingesperrt bist. Ab und zu darfst du mit den anderen Insassen raus in den Hof. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Weshalb du in diesem Resozialisierungsprogramm gelandet bist, ist dir nicht klar. Was du weisst ist, dass deine Grenzen noch nie respektiert wurden und du dich immer aktiv dafür einsetzen musstest. In regelmässigen sogenannten Trainingseinheiten wirst du von Menschen bedrängt, bedroht, geschlagen und getreten. Das Ziel ist, dass du dich nicht mehr wehrst.
Doch du bist eine Kämpferin.
Du lässt dich nicht brechen. Und das ist ein Problem. Denn Resozialisierung wird hier so verstanden, dass erlernte Hilflosigkeit das Ziel ist. Abgelöschte Wesen, die sich nicht mehr wehren, wenn ihre Grenzen überschritten werden. Die keine eigenen Entscheidungen mehr treffen und nur noch etwas tun, wenn sie einen klaren Befehl dazu erhalten haben. Doch du bist eine Kämpferin. Auch nach 30 Jahren wehrst du dich noch immer gegen die Behandlung. Du schlägst zurück, wenn du geschlagen wirst. Du schreist, wenn du angeschrien wirst. Du stellst dich ihnen entgegen. Mit all deiner Kraft und all deinem Willen. Sie sagen, du testest immer noch die Grenzen aus. Dabei willst du einfach nur überleben, ohne dich selbst aufzugeben. Sie sagen, du kannst so nicht raus in die Gesellschaft. Vielleicht kannst du es auch nicht mehr, so lange schon bist du dort, dass du nichts anderes mehr kennst.
Sie sagen, du brauchst die Gewalt, sonst würde alles noch viel schlimmer werden. Ist das so? Wäre es wirklich so, dass du aggressiv reagieren würdest, wenn jemand käme, der deine Grenzen respektieren würde? Wenn jemand käme, der dir Raum und Zeit lassen würde, der dir zeigen würde, dass du von ihm nur Gutes zu erwarten hast?

Ein ganz besonderes "Kostenlos & Live" zum Abschluss des Jahres 2024! 🖤
🐾 Für wen?
Für Menschen, die gemeinsam mit ihrem Hund einen achtsamen Abschluss des Jahres feiern möchten.
Was erwartet dich?
🔥Eine geführte Meditation zur Reflexion des Jahres.
🔥Loslassen, was dich runter zieht und feiern, was ihr alles geschafft habt.
🔥Raum, um persönliche und gemeinsame Ziele für das neue Jahr zu formulieren.
📅 Datum: 17.12.2024
🕖 Uhrzeit: 20.00
📍 Ort: Zoom
🎟️ Teilnahme: Hol dir dein Ticket und kommentiere mit 🔥 für den Link.

Das Reel, welches in den letzten Tagen für Aufruhr gesorgt hat, hat Stand 17.11. um 11.01 Uhr 45.2 Tsd. Views. Die anderen «Werke» dieser Person haben durchschnittlich 5 Tsd. Views. Was ist passiert? Sie hat gequirlte 💩in die Welt getragen und viele viele Menschen haben aktiv geholfen, diese möglichst weit zu verbreiten.🙃Eigentlich würde ich gerne eine Auswertung machen, wie das Verhältnis zwischen Zustimmung und Ablehnung in der Kommentarspalte aussieht. Ich könnte mir vorstellen: 50/50? (Mache ich aber nicht, denn meine Zeit sinnvoll zu nutzen bedeutet mir viel und ich will dieses Thema mit diesem Post nun abschliessen). Sicherlich hat es aber mindestens einige Kommentare, die sich gegen den Inhalt aussprechen. Sicher mit der besten Absicht und dem Ziel, zu berichtigen, zu informieren und für Klarheit zu sorgen. Das Reel hat nicht nur fleissig Kommentare gesammelt, sondern es wurde auch einige Male weitergeleitet – auch ich habe es zugeschickt bekommen, mehrfach. Und zwar nicht von Menschen, die aversiv arbeiten. Denn solche gibt es in meiner Bubble nicht.❤️
Was ist passiert? Nebst der Tatsache, dass sich hunderte Menschen über das Reel aufgeregt, viel Zeit und Energie investiert haben in Posts, Diskussionen und Kommentare, wurde der Algorithmus so richtig in Wallung versetzt.🔥 Das Beste, was einem Reel passieren kann sind viele Views, Kommentare und Weiterleitungen innert kurzer Zeit. 🚀
Was sollten wir also tun, wenn wir sowas sehen? Nichts. Oder noch besser: auf die drei Punkte tippen, «kein Interesse» wählen oder «melden» wenn aktiv zu Gewalt aufgerufen oder Fehlinformation verbreitet wird.🚫Als nächstes überlegst du dir, welchen Inhalt du davor gesehen hast, der dir gefallen hat oder der dir einen Mehrwert geliefert hat.❤️ Gehe zurück zu diesem Beitrag, like ihn, teile ihn mit anderen und kommentiere darunter. So sorgst du aktiv dafür, dass wertvolle Inhalte in die Welt getragen werden und Mist höchstens auf dem Feld der Verursacher verbreitet wird.🔥
#reaktiverhundimtraining #hundetraining #hundeschule #mitdemhundunterwegs #reaktiverhund #hundetrainerschweiz #positivestraining #positivundlaut #hundecoaching #bedürfnisorientierteshundetraining

Auch wenn ich weiss, dass ein Apfel mir besser tun würde als ein von Zucker und Fett triefender Brownie, entscheide ich mich leider öfter für den Brownie. Warum? Weil wir viel stärker von Emotionen, Kindheitserfahrungen und vielleicht sogar -trauma getrieben sind. Wenn ich gestresst bin und mich vielleicht gerade über einen Post auf Insta geärgert habe, verschafft mir der Brownie kurzfristig ein gutes Gefühl. 🤤 Vielleicht habe ich als Kind die Erfahrung gemacht, dass Essen als Bewältigungsstrategie eingesetzt werden kann. Im Sinne von: «Wein doch nicht! Komm, du kannst ein Stück Schoki haben.»
Deshalb werden wir über die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse wohl nur wenige Menschen dazu bringen, sich für R+ basiertes Training zu interessieren. Die Emotionen und Bedürfnisse sind einfach stärker. 🤷♀️ Die Angst, dass der Hund ausser Rand und Band gerät, wenn ich nicht hart durchgreife. Das Bedürfnis nach Akzeptanz, wenn mein Hund den Nachbarn verbellt. Die Verzweiflung, wenn ich das Gefühl habe, keinen Einfluss auf das Verhalten meines Hundes zu haben.😱 Und hier liefern viele aversiv arbeitende Trainerkolleg:innen den passenden Haken: «Wenn du nicht strafst, passiert genau das! Du verlierst die Kontrolle, dein Hund fällt den Nachbarn an und hey, du willst doch keine positiv Petra sein, oder? Dann finden dich nämlich alle scheisse!» 💩
Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn überhaupt, Überzeugungsarbeit über Emotionen und Bedürfnisse betreiben. Zum Beispiel: «Mir ist Einflussnahme und Kontrolle sehr wichtig. Deshalb führe ich meinen Hund an der Leine und trainiere mit ihm ein Alternativverhalten für Hundebegegnungen. Dabei setze ich auf positives Training, weil mir auch Gewaltfreiheit und Empathie sehr wichtig ist. Wenn dir das auch wichtig ist, kann ich dir gerne eine tolle Trainer:in empfehlen / mal zeigen, wie das geht / mehr darüber erzählen…» 🖤
Vorwürfe oder moralische Urteile bringen uns nicht weiter! Wir überzeugen niemanden, wenn wir uns moralisch überlegen zeigen. Damit graben wir den Graben nur noch tiefer.

Die Diskussion über den «positiv-Wahn» hat mir leider wieder einmal gezeigt, was ich eigentlich schon lange weiss: Wir können nicht jede:n retten. Wir können nicht bewirken, dass Menschen fair mit ihren Hunden umgehen. Das können nur diese Menschen selbst und nur, wenn sie es wollen. Und hier ist der springende Punkt: Was bewegt Menschen dazu, ihren Hund positiv zu strafen? Ich verstehe, dass man das Bedürfnis nach Kontrolle und Einflussnahme hat, wenn der Hund an der Leine ausrastet. Ich kann nachvollziehen, dass man das Bedürfnis nach Sicherheit hat, wenn der Hund das Kind anknurrt. Ich sehe ein, dass Menschen Verlässlichkeit wichtig ist, wenn der Hund im Freilauf ist.
Wenn unsere Bedürfnisse nicht befriedigt werden, löst das negative Emotionen aus. Verzweiflung und Hilflosigkeit, wenn der Hund jeden anderen verbellt. Angst und Schock, wenn der Hund das Kind anknurrt. Zorn, wenn der Hund nicht auf den Rückruf hört und ein anderes Mensch-Hund-Team belästigt. Das ist menschlich und normal. ABER: Unser Hund und sein Verhalten sind nicht dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen! Es ist nicht seine Aufgabe dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Wir selbst sind dafür verantwortlich. Es liegt an uns, zu schauen, wie wir das Bedürfnis nach Kontrolle und Einflussnahme stillen können, wenn wir einen reaktiven Hund haben. Es ist unsere Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen, wenn wir mit Hund und Kind zusammenleben. Und es ist an uns, Verlässlichkeit zu schaffen.
Es gibt zwei Wege, das zu tun: wir können positiv oder aversiv trainieren. Wenn wir aversiv trainieren, fühlen wir uns vielleicht stark und machtvoll dabei. Und niemand sagt, dass positive Strafe nicht funktioniert. Sie hat aber erwiesenermassen Nebenwirkungen ➡️ siehe dazu unseren letzten Post. Eine möchte ich hervorheben: Aversives Training wird in Zusammenhang mit erhöhtem Aggressionsverhalten gegen Menschen gebracht und damit Problemverhalten zu verursachen. Why choose this way?🤷♀️
Es ist also besser, positiv zu trainieren. Denn auch hier kann ich Einfluss nehmen auf meinen Hund, ich kann Verbindung, Verlässlichkeit und Vertrauen stärken und Orientierung und Klarheit schaffen. Für mich UND meinen Hund. 🖤

Ein kleiner Einblick in unser Gruppentraining "zämä chillä". Die Mensch-Hund-Teams lernen, zusammen Spass zu haben, sich aufeinander zu fokussieren und auch in Anwesenheit anderer Menschen und Hunde gelassen zu bleiben. 👩🎤 Und sie rocken einfach JEDES Training! 🖤
#reaktiverhundimtraining #hundetraining #hundeschule #mitdemhundunterwegs #reaktiverhund #hundetrainerschweiz #positivestraining #positivundlaut #hundecoaching #bedürfnisorientierteshundetraining
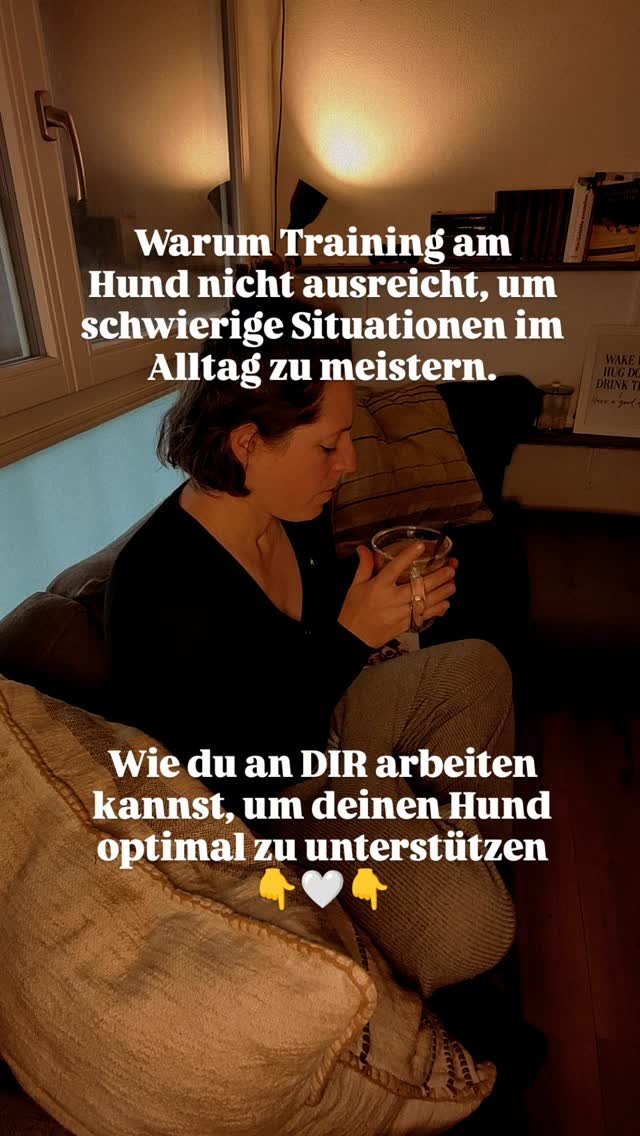
First of all: es geht nicht um Schuldzuweisung, wenn ich sage, dass Stimmungsübertragung ein wesentlicher Faktor in herausfordernden Situationen mit deinem Hund ist. 🖤 Aber, to be honest: Es ist ein Fakt, dass unsere Stimmung einen Einfluss auf das Verhalten unserer Hunde hat. So haben zum Beispiel die Studien von Wilson et al 2022 oder Bräuer und Blasi 2021 ergeben, dass Hunde die Stresshormone ihrer Menschen sogar wahrnehmen, wenn sich diese in einem anderen Raum aufhalten! 🤯
Und deshalb ist Training am Verhalten deines Hundes leider nur die halbe Miete! 😓 Solange du gestresst bist, wenn ein anderes Mensch-Hund-Team am Horizont auftaucht, wird es deinem Hund sehr schwer fallen, das im Training gelernte umzusetzen.💥
Damit dein Hund ohne zu zögern auf deine Signale einsteigt, das aufgebaute Alternativverhalten zeigen kann und ihr ENDLICH eure Herausforderungen zusammen rockt, braucht es Training an beiden Enden der Leine!⭐
🖤Achtsamkeit: Werde dir deinen Emotionen und Bedürfnissen bewusst. Denn schon nur wahrzunehmen, was es bei dir auslöst, wenn du eine schwierige Situation mit deinem Hund erlebst, ist ein riesen Gamechanger!
🖤Meditation: Es ist erwiesen, dass eine regelmässige Meditationspraxis Stresshormone wie Cortisol schneller abbaut und Menschen in stressigen und herausfordernden Situationen eher ruhig und gelassen bleiben können - genau das, was unser Hund braucht, wenn es heikel wird.
🖤Management: Achtung, das ist KEIN Training und bringt euch im Verhalten nicht weiter. ABER, es hilft euch, im Alltag schwierige Situationen zu bewältigen und schafft dadurch Vertrauen in dich und deinen Hund.
🖤Visualisieren: Einen Plan zu haben in heiklen Situationen ist das A und O. Du lernst, wie du Visiualisierungen gezielt nutzen kannst, um deinem Hund zu zeigen: No stress, I know what to do.
Genau da setzt CALM YOUR DOG an!✨ Du lernst, wie dein Hund und du Stress besser regulieren könnt, ihr beginnt die gemeinsame Meditationspraxis in vollen Zügen zu geniessen um so immer mehr zu dem Dreamteam zu werden, das auch schwierige Situationen im Alltag und auf euren Abenteuern zusammen rockt!👩🎤🖤


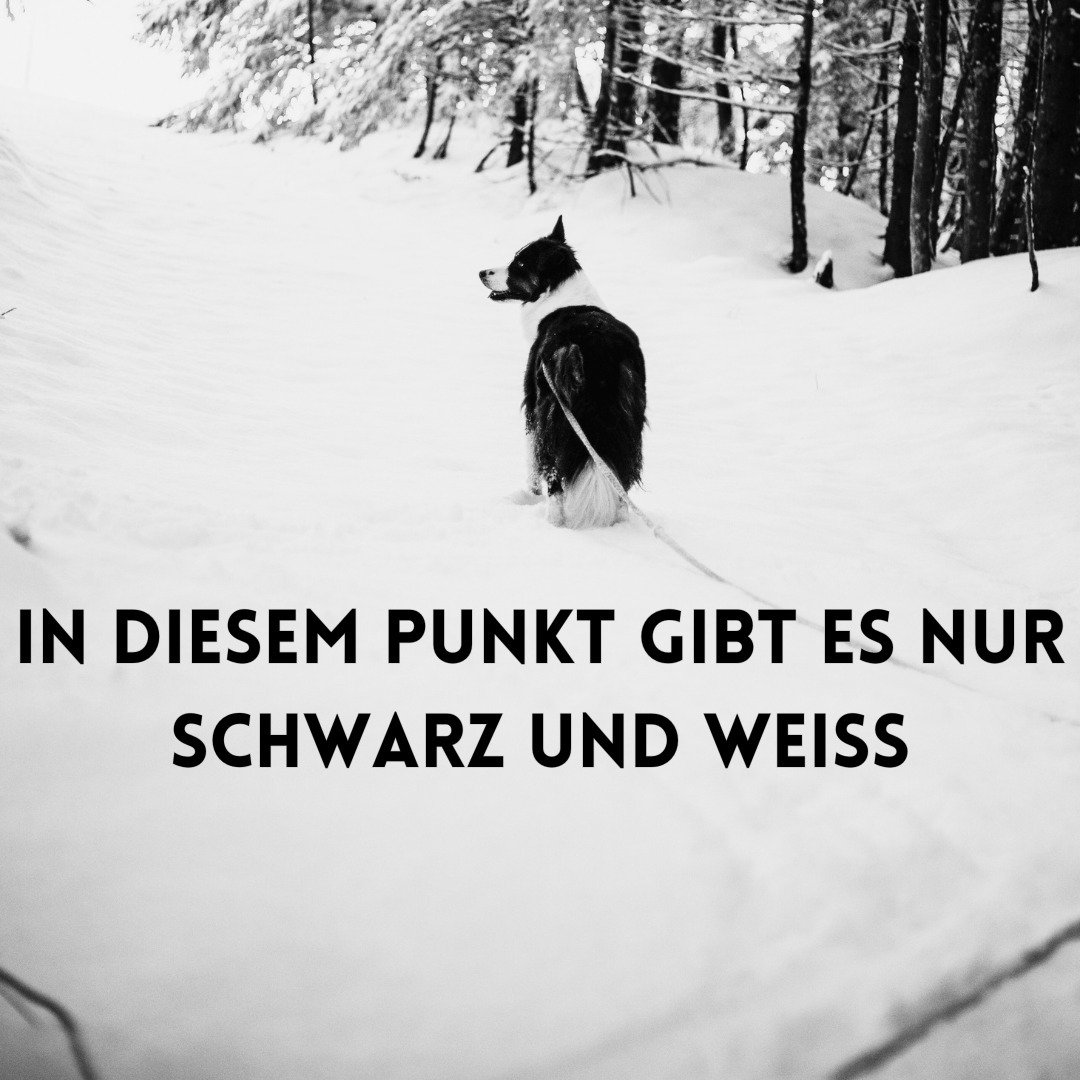





Instagram-Beiträge Christoph
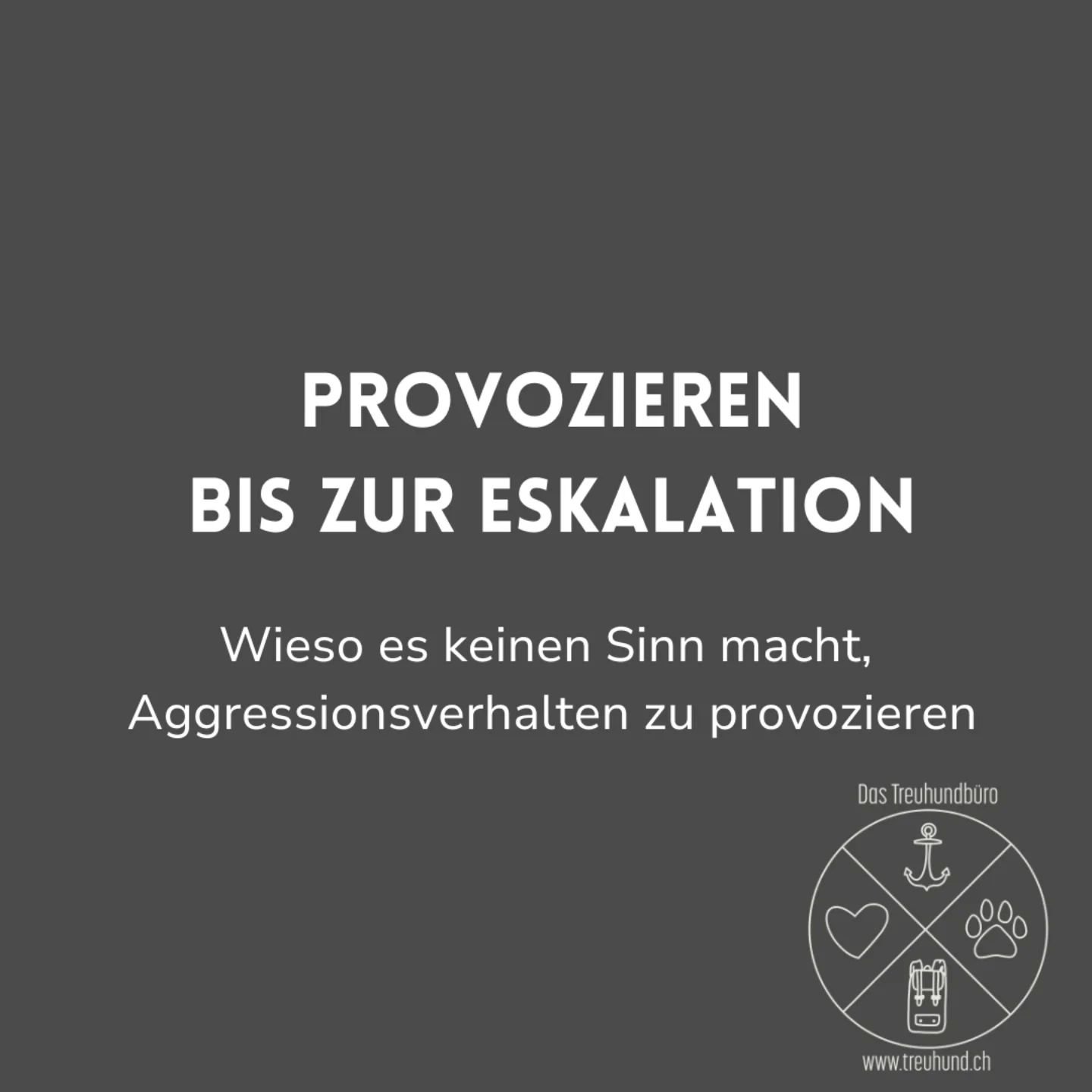
Immer wieder sieht man es: Hunde werden absichtlich solange provoziert, bis sie Aggressionsverhalten zeigen. Das danach bestraft wird. Dieses Vorgehen ist aus mehreren Gründen völlig abwegig.
Diese Art des Trainings kann dazu führen, dass Hunde (noch verstärkt) lernen, dass ihre Kommunikation missachtet wird. Wenn ich nämlich einen Hund aktiv provozieren muss, damit er Aggressionsverhalten zeigt, ignoriere ich bewusst alle anderen körpersprachlichen Signale des Hundes, wie etwa Droh- oder Meideverhalten. Diese Verhaltensweisen werden aufgrund eines solchen Trainings vom Hund als nicht funktional (also "nicht erfolgreich") wahrgenommen. Das heisst: Diese Verhaltensweisen werden zukünftig weniger oder gar nicht mehr gezeigt (und somit direkt auf Aggressionsverhalten zurückgegriffen wird).
Ein solches Training kann zudem zu starkem Misstrauen gegenüber Menschen führen. Wie wir im letzten Post gelernt haben, ist Angst ein grosser Faktor bei Aggressionsverhalten. Habe ich nun also einen ängstlichen Hund vor mir und provoziere Aggressionsverhalten, füge ich diesem Hund nichts anderes als noch mehr Angst zu (ansonsten würde das Aggressionsverhalten nicht auftreten). Zum Einen ist dies in einer tierschutzrechtlichen Grauzone - in der Schweiz darf ein Hund im Training nicht in Angst versetzt werden -, zum Anderen erlebt ein per se schon ängstlicher Hund erneut eine starke negative Emotion der Angst. Verknüpft er diese auf Menschen, kann Aggressionsverhalten nur beim geringsten Auslöser auftreten. Zudem wird er allgemein pessimistischer, furchtsamer gegenüber der Umwelt - bis hin zu erlernter Hilflosigkeit.
Zudem: Provoziere ich Aggressionsverhalten, bin ich selbst verantwortlich dafür. Ich als Trainer bin der direkte Auslöser und habe mit meinem eigenen aggressiven Verhalten (!) die Eskalation des Hundes herbeigeführt. Training an Aggression, indem ich selbst aggressiv bin? Was, bitte schön, lernt der Hund denn da(ausser, dass Trainer:innen richtig doof sind - und wenn's ganz schlimm kommt: dass alle Menschen richtig doof sind)?
Das heisst: Weder zur Behandlung von Aggression selbst noch lerntheoretisch macht dieses Vorgehen Sinn. Vielmehr schadet es unseren Hunden.
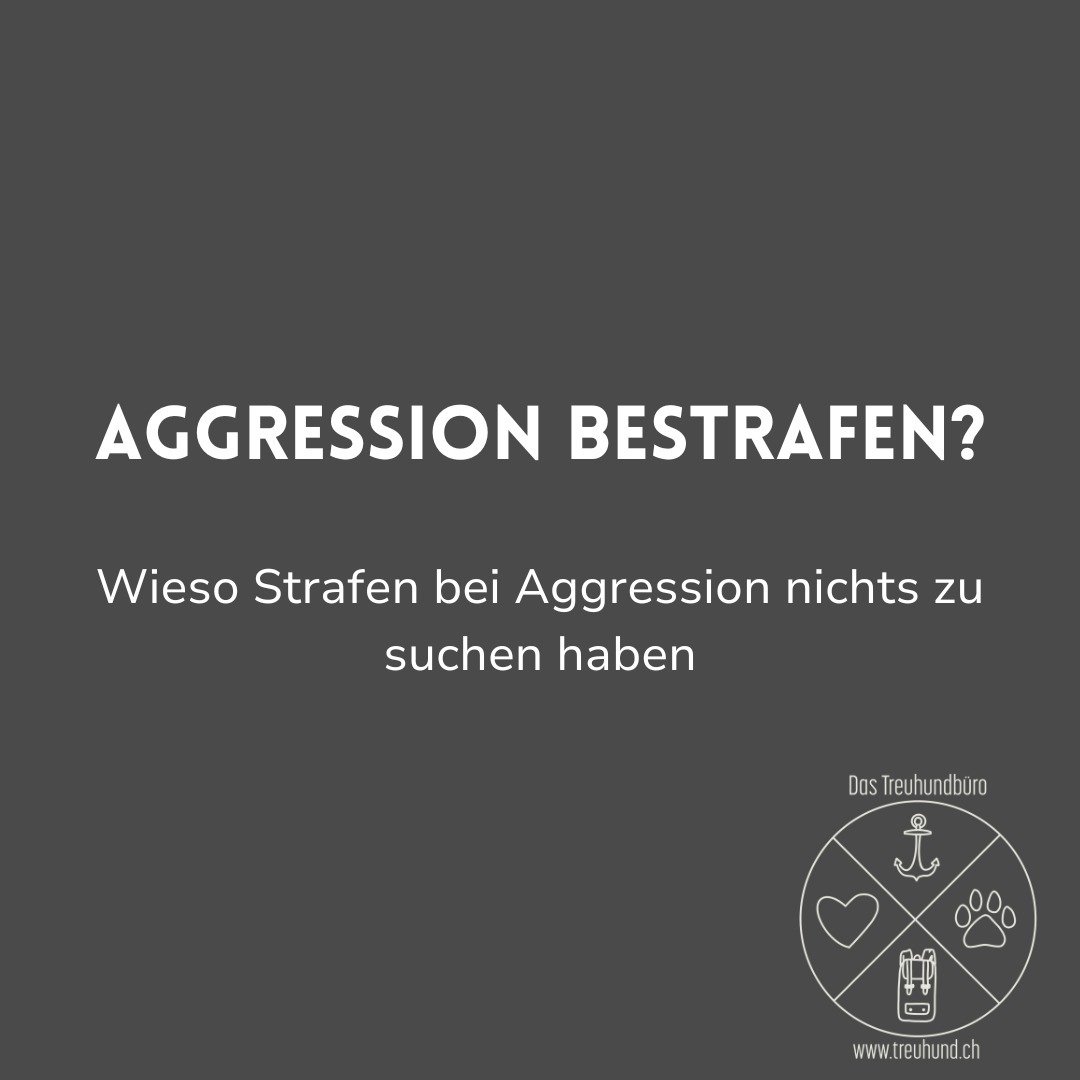
Das im Zusammenhang von Aggressionsverhalten beim Hund strafbasierte Methoden angewendet werden, scheint vielleicht auf den ersten Blick naheliegend. Auf den zweiten Blick jedoch stellen wir schnell fest, als dass dieses Vorgehen absolut kontraproduktiv und unfair dem Hund gegenüber ist.
Damit wir dies verstehen, müssen wir zunächst wissen, was die häufigsten Ursachen für Aggression beim Hund sind. Aggressionsverhalten ist nämlich sehr oft eine Geschichte der Angst oder der Schmerzen. Dazu kommen Schlafmangel, Stress (akut als auch chronisch) sowie "Auswegslosigkeit" (Horwitz & Mills, 2010) als häufigste Auslöser hinzu. Grundlage ist also meist eine stark negative Emotion - entweder generell oder bezogen auf einen bestimmten Auslöser.
Wende ich nun bei Aggressionsverhalten strafbasierte Methoden an, hat der Hund im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie er damit umgehen kann: Er ändert seine Konfliktstrategie (von Aggressions- etwa hin zu Fluchtverhalten) oder aber er eskaliert das aggressive Verhalten. Dem Hund wird also überhaupt nicht geholfen, vielmehr wird die negative Emotion gegenüber einem Auslöser gar noch potenziell verstärkt. Der Ursprung des Aggressionsverhaltens - die starke negative Emotion - wird dabei ausser Acht gelassen.
Auch das Provozieren von Aggressionsverhalten ist absolut abwegig und niemals Teil eines guten Hundetrainings. Denn wenn ich das Aggressionsverhalten eines Hundes erst provozieren muss, damit es gezeigt wird, heisst das auch, dass der Hund zuvor "gesellschaftskonformes" Verhalten zeigen würde, das ich verstärken könnte. Die Provokation ist also de facto absolut unnötig.
Strafbasierte Methoden können zudem gravierende "Nebenwirkungen" nach sich ziehen: Generell vermehrtes Auftreten von Aggression, rückwärtsgerichtetes Aggressionsverhalten (nicht mehr der Auslöser wird angegangen, sondern der eigene Mensch, da dieser als weiterer Auslöser wahrgenommen wurde), generell mehr Ängstlichkeit, erlernte Hilflosigkeit, Vertrauensbruch zwischen Hund und Mensch usw.
Strafbasierte Methoden sind also nie Teil einer guten Verhaltenstherapie. Ebenso wenig haben sie Platz in einem guten Hundetraining.

Immer wieder lese ich: "Damit dein Hund gut an der Leine läuft, musst du eine gute Beziehung zu ihm haben!". Ist die Beziehung gut, dann solle, so die Annahme, alles wie von selbst funktionieren. Doch: Welchen Einfluss hat die Beziehung auf das Verhalten des Hundes überhaupt?
Eine Arbeit von Deldalle & Gaunet (2014) legt den Schluss nahe, als dass positives Training für eine bessere Beziehung zwischen Mensch und Hund sorgt. Dies bedeutet: Der Hund schaut seinen Menschen öfters an und wendet ihm vermehrt seine Aufmerksamkeit zu - stets im Vergleich zu der Vergleichsgruppe aus den balanced bzw. aversiv trainierten Hunden. Eine Arbeit von de Castro und Kollegen (2021) scheint diesen Umstand zu bestätigen: Ist die Beziehung freundlich, liebevoll etc. (und somit "gut"), beschäftigen sich Hunde vermehrt mit ihrem Menschen als bei einer "schlechten" Beziehung.
Mehr Aufmerksamkeit dem Menschen gegenüber hat aber ziemlich wenig mit Fuss laufen oder Rückruf zu tun. Mein Hund Garou kann sich zum Beispiel immer noch extrem gut an mir orientieren, selbst wenn er 5km entfernt ist, geschweige muss er mich anschauen, um sich an mir zu orientieren - dafür hat er ganz andere, bessere Sinne wie Geruch oder Gehör.
Eine gute Beziehung ist meines Erachtens auch dadurch geprägt, als dass die Beziehungspartner:innen Vertrauen in den jeweils anderen haben. Dadurch können sie den Mut aufbringen, etwas Neues zu probieren und somit auch Fehler zu begehen. Ein Hund, der "perfekt funktioniert", kann also auch auf eine Beziehung hindeuten, die von Angst, Misstrauen oder Strafe geprägt ist. Dies zeigt etwa eine Arbeit von Topál, Miklósi & Csányi (1997): Die Art der Beziehung hat Einfluss auf das selbstständige Problemlösungsverhalten des Hundes. Ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund gut, ist das Problemlösungsverhalten der Hunde besser. Eine andere Arbeit von Casey et al (2021) zeigt, dass Hunde, die eine gute Beziehung zu ihrem Menschen haben, neugieriger gegenüber der Umwelt sind und diese "optimistischer" als auch vermehrt erkunden.
Eine gute Beziehung zwischen Mensch und Hund fördert beim Hund also Eigenständigkeit, Selbstwirksamkeit, Mut usw. - und nicht Abhängigkeit.

Die Frage für uns Hundemenschen lautet: Wann ist es zu viel? Ich persönlich habe zwei Kriterien, die ich unabhängig vom Auslöser betrachte. Erstens: Ist mein Hund ansprechbar und reagiert auf meine Signale? Zweitens: Beeinträchtigt das Bellen das Ruhe- und Schlafbedürfnis meines Hundes?
Wenn mein Hund auf meine Signale reagiert, weiss ich, dass der auslösenden Reiz nicht mit einer starken Emotion verknüpft ist (ansonsten könnte mein Hund nämlich nur schwer oder gar nicht mehr auf meine Signale reagieren). Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Hund generell viel bellt, führe ich indessen ein Aktivitätenprotokoll. Dabei erfasse ich Aktivitäts- und Ruhezeiten als auch das Bellen (Länge und ggf., sofern möglich, Auslöser und die zugrundeliegende Emotion). Stelle ich anhand des Protokolls fest, dass mein Hund während Ruhezeiten immer wieder bellt und somit seine Ruhe- und Schlafenszeit von mind. 18 Stunden nicht erreicht, muss ich handeln.
Die Massnahmen sind dabei mannigfaltig und stark individuell: Bei einigen Hunden reicht es aus, die Fenster mit Milchglasfolie abzudecken (was bei anderen Hunden eine Verstärkung des Verhaltens bewirken kann), bei anderen reicht es, ein Umorientierungssignal zu trainieren (Vorsicht, Verhaltenskette). Teilweise ist auch die Arbeit an der allgemeinen Erregungslage notwendig, etwa mit konditionierter Entspannung, dem Einrichten einer Sicherheitszone etc. Und bei wiederum anderen ist eine Gegenkonditionierung an einem spezifischen Reiz angesagt.
Beachten müssen wir dabei auch unsere Mitmenschen. Hundegebell ist einer der grossen Streitpunkte in der Nachbarschaft. In der Schweiz gibt es dazu keine einheitliche Regelung. Der Hauseigentümerverband meint, dass ein Hund maximal 30 Minuten am Tag sowie 10 Minuten am Stück bellen darf. Die Stiftung Tier im Recht ist hingegen der Meinung, dass 1 Stunde pro Tag ebenfalls okay sei. Hinweis: Oftmals ist es so, dass sich eine Person nicht grundsätzlich über das Gebell "nervt", sondern nur über das Gebell, wenn diese Person im Garten ist ("immer, wenn ich im Garten bin, bellt dieser Hund!"). Das heisst: Der auslösende Reiz dürfte hier die (fremde) Person im Garten sein.

Der erwachsene Wolf bellt fast nie (nur zur Warnung der anderen Rudelmitglieder). Wolfswelpen bellen im Vergleich dazu um einiges öfters. Forschende meinen, dies sei ein weiterer Beleg dafür, als dass in der Geschichte der Domestikation vor allem welpentypische Eigenschaften des Wolfes durch Zucht und Auswahl bei Hunden bevorzugt wurden (was sich u.a. beim Spielverhalten zeigt, wo viele körpersprachliche Kommunikation des Wolfes beim Hund durch Bellen ersetzt wurde; siehe Feddersen-Petersen, 2004). Dabei bellen Hunde vielfältiger und variabler als Wölfe (Abrantes, 2005).
Bellen kann dabei aufgrund seiner Tonalität eingeschätzt werden. Je tonaler (harmonischer, melodiöser) und höher (hochfrequenter) ein Bellen ist, desto mehr Aufregung ist beim Hund vorhanden, etwa bei Spiel, Freude oder Frustration. Je tiefer und atonaler (geräuschhafter, rauer) das Bellen ist, desto mehr deutet das Bellen auf eine aggressive Motivation hin. Dabei sind auch Mischformen bei Ambivalenz möglich (Pongrácz, Molnár & Miklósi. 2010). Es wird weiter vermutet, dass Bellen eine für den Hund beruhigende Wirkung zeitigt und somit selbstbelohnend wirken kann (Yin & McCowan, 2004)
Die Einordnung von Bellen in sogenannte Bellformen ist dabei je nach Literatur äusserst unterschiedlich (Ryan, 2000; Rugaas, 2007; Feddersen-Petersen, 2008). So kann unterschieden werden zwischen
Aufregungsbellen
Spielbellen
Aufforderndes Bellen
Angstbellen
Keifen
Einsamkeitsbellen
Frustrationsbellen
Jagdbellen
Wuffen
Drohendes Bellen
Die Selektion ergab dabei "unterschiedliche" Hunde: Bei einigen ist die "Bellfreude" insgesamt gesteigert. Diese Hunde neigen bei Erregung zum Bellen, unabhängig des Auslösers. Andere Hunde reagieren vermehrt auf spezifische Auslöser mit Bellen (etwa bei Jagdverhalten oder Territorialität). Oft wird dabei vergessen, dass Bellen lange Zeit ein wichtiges Selektionskriterium war, da das Bellen bei Hunden für den Menschen als gutes Warn- bzw. Alarmsystem diente (Miklósi, 2014).
Bellen ist also natürlich. Und was uns unsere Hunde damit sagen wollen, äusserst unterschiedlich und individuell. Doch gibt es ein "zu viel"? Und wenn ja, was tun? Dazu mehr im nächsten Beitrag.
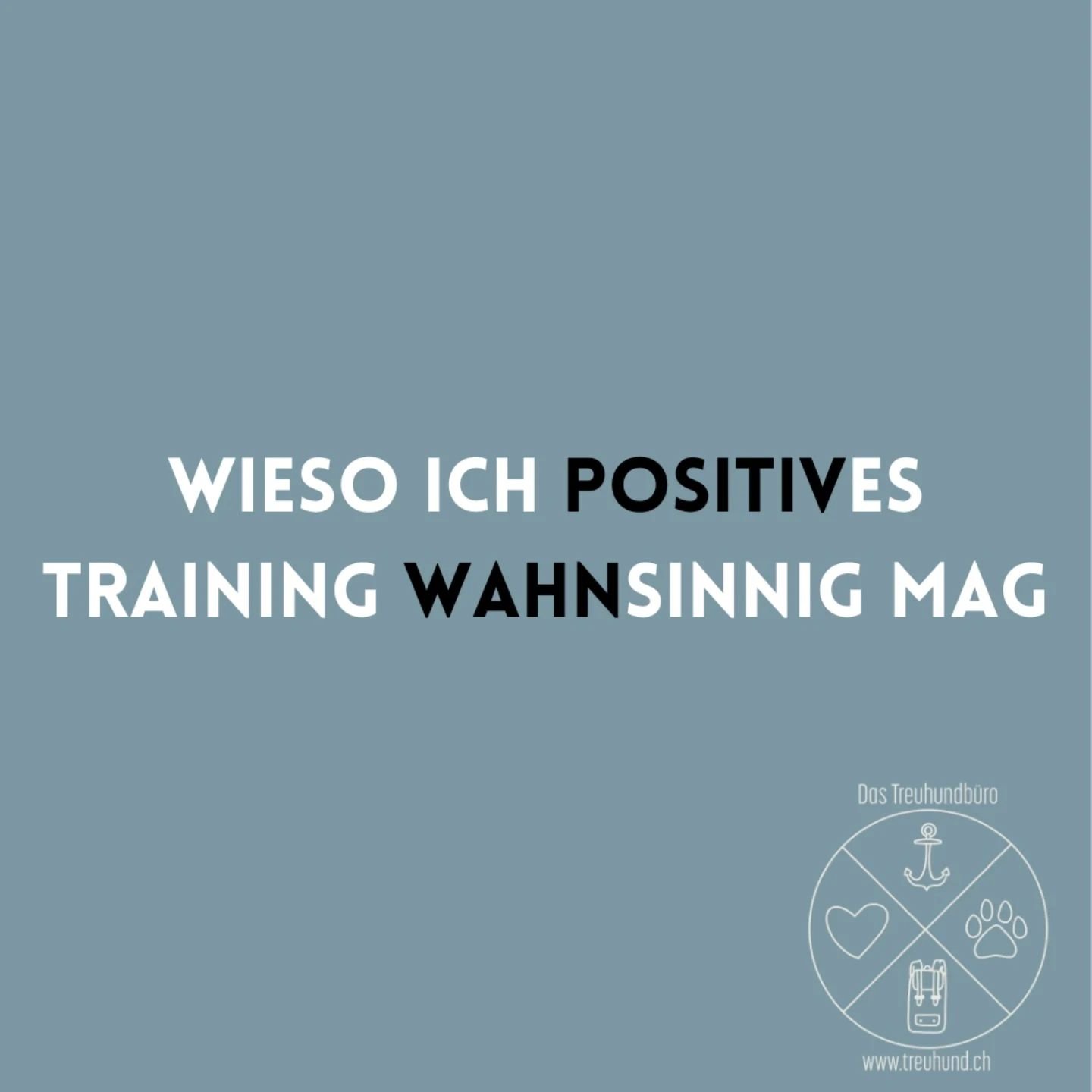
Wieder mal wird von einem "positive only-Wahn" gesprochen. Und ja: Ich hab ein bisschen einen Wahn diesbezüglich. Denn:
Aversive Trainingsmethoden können einen negativen Einfluss auf die Beziehung zwischen Hund und Mensch haben (u. a. Deldalle & Gaunet, 2014; La Follette et al, 2019; Hart & King, 2023).
Strafbasierte Methoden werden in Zusammenhang mit erhöhten Aggressionsverhalten gegen Menschen gebracht (u.a. Arhant et al, 2010; Casey et al, 2013, Walsh, 2024).
Allgemein scheint es so, als dass aversives Training Problemverhalten eher verursacht (u.a. Bradshaw, Rooney & Hiby, 2004; Lord et al, 2020; Bräm Dubé et al, 2020; Shih, Descovich et al, 2023; Brand et al, 2024).
Hunde, die aversiv trainiert werden, sind gestresster, ängstlicher und verhalten sich "pessimistischer" in der Umwelt (u. a. de Castro et al, 2021; Casey et al, 2021).
Strafbasierte Trainingsmethoden können direkt Aggressionsverhalten auslösen (u.a. Herron, Shofer & Reisner, 2009; Dale, 2024).
Positives Training ist effektiver beim Erreichen von Zielverhalten (u.a. Ben-Michael et al, 2000; Haverbeke et al, 2008; Rooney & Cowan, 2011; China, Mills & Cooper, 2020).
Die Lernfähigkeit des Hundes scheint beim positiven Training besser zu sein (u.a. Alexander, Friend & Haug, 2011; Polgár, Blackwell & Rooney, 2019; Hall et al, 2021).
Kooperation und Motivation des Hundes scheinen beim positiven Training höher zu sein (u.a. Fischer-Tenhagen, Johnen et al, 2017; Fattah & Abdel-Hamid, 2020).
Das Wohlbefinden der Hunde wird durch positives Training gestärkt (u.a. de Castro et al, 2019; Jones, 2023; Reicher et al, 2024).
Positives Training ist "fehlertoleranter" in dem Sinne, als dass eine falsche Anwendung von positiver Verstärkung nicht so gravierende Folgen hat wie bei aversiven Methoden (Blackwell & Casey, 2006).
Das Risiko, dass Hunde bei Tierärztinnen-Besuchen Aggressionsverhalten zeigen, wird durch positives Training offenbar gesenkt (Stellato et al, 2021).
Und auch im Verhaltenstraining wird erfolgreich positiv gearbeitet (Daniels et al, 2023; Kim & Bain, 2024).
Die angegebenen Quellen könnt ihr mit den entsprechenden Textpassagen in meinen Highlights und auf Google Scholar finden.

Ein Hund hat - wie wir Menschen auch - Grundbedürfnisse. Nahrung, Bewegung, Ruhe und Schlaf, körperliche Unversehrtheit usw. Zudem gibt es weitere essentielle Bedürfnisse wie Sozialkontakt (zum Menschen und/oder Artgenossen) oder allgemein Sicherheit. Viele weitere Bedürfnisse können zudem individuell und je nach Charakter des Hundes sein: Geistige und/oder körperliche Belastung, Spielen, Kuscheln etc.
So weit, so simpel. Kompliziert wird es, wenn die Bedürfnisse von uns oder unserem Umfeld - Bekannte, Verwandte usw. - auf Hunde übertragen werden und einfach mal "so" angenommen wird, es seien ebenfalls die Bedürfnisse von unseren Hunden. Viele Eltern (und ggf. auch die Kinder) haben etwa das Bedürfnis, dass Kinder und Hund zusammen spielen. Dies kann tatsächlich ein Bedürfnis des Hundes sein - muss es aber nicht (vielmehr kann es sein, dass es das Bedürfnis des Hundes ist, von den Kindern in Ruhe gelassen zu werden). Oder: Viele Besucher:innen haben das Bedürfnis, den Hund zu streicheln und knuddeln. Auch hier: Das kann auch ein Bedürfnis des Hundes sein, oder eben auch nicht.
Sehr oft haben wir Menschen Schwierigkeiten, die Bedürfnisse von uns und unserem Umfeld mit jenen von unseren Hunden unter einen Hut zu bringen. Und sehr oft gehen da die Bedürfnisse - bewusst oder unbewusst - des Hundes unter. Werden jedoch die Bedürfnisse eines Hundes über längere Zeit ignoriert, führt dies oft zu (von uns so genanntem) Fehlverhalten: Der Hund knurrt die Kinder plötzlich an oder verbellt den Besuch.
Mehrere Dinge müssen uns diesbezüglich bewusst sein. Erstens: Unsere Hunde sind nicht dafür da, Bedürfnisse von anderen zu befriedigen. Weder von Kindern, noch von Besuch, noch von uns selbst. Zweitens: Es können nicht immer alle Bedürfnisse befriedigt werden. Weder von anderen, noch von uns, noch vom Hund. Wichtig ist hier, als dass sämtliche Bedürfnisse Beachtung finden, respektiert werden und, wenn möglich, anderweitig befriedigt werden. Drittens: Uns und unseren Hunden muss wohl sein. Sich in Situationen zu "zwingen", nur um die Bedürfnisse von anderen zu befriedigen, führt meist nicht zum Ziel - sondern eher zu hohem Stress. Bei uns wie bei unseren Hunden.

Nach einem tragischen Beiss-Vorfall durch einen Rottweiler wird im Kanton Zürich gerade über das Verbot von Rottweilern und Dobermännern diskutiert. Das heisst: Es wird implizit wiederum behauptet, als dass die Rasse Einfluss auf die Gefährlichkeit (bzw. das Aggressionsverhalten) eines Hundes hat. Stimmt das?
Die kurze Antwort: Nein, das stimmt nicht.
Die lange Antwort: Es gibt Studien, die aufzeigen, dass Genetik keinen übergeordneten Einfluss auf späteres Verhalten hat. Je nach Studienergebnis ist die prozentuale Anzahl an Verhalten, das tatsächlich genetisch fixiert ist, relativ gering. Hoffmann (2000) konnte eine äusserst geringe Heritabilität (Erblichkeitsrate von Verhalten) bei Hütehundenrassen (Australian Shepherd, Border Collie) feststellen, dasselbe bei Schäferhunden in der Schweiz (Rüfenacht et al, 2004) oder bei Jagdgebrauchshunden in den USA (Brade, 2003). Auch neuere Arbeiten (etwa von Hradecka et al, 2015; von Holdt & Driscoll, 2016 oder van den Berg, 2017) kommen "auf eine recht geringe Erblichkeit für die Verhaltenseigenschaften" (Ganslosser, 2020). Svartberg et al (2006) konnten immerhin eine etwas höhere Erblichkeit für Furchtsamkeit bei Schäferhunden sowie Rottweilern feststellen (im Vergleich zu anderen Verhaltensmerkmalen), auch wenn dieser immer noch unter der erwarteten Heritabilität lag.
Auch treten die oft als gefährlich assoziierten Rassen in Untersuchungen nicht übermässig häufig auf. Vielmehr sind es andere Rassen, die diese Untersuchungen anführen: Etwa Labrador Retriever (Guy et al, 2001), Deutscher Schäferhund (Gershman, Sacks & Wright, 1994), Cocker Spaniel (Overall & Love, 2001) oder Chihuahua (Kogan et al, 2022). Eine Arbeit von Hammond, Rowland, Mills & Pilot (2022) kamen zum Schluss: "Our findings indicate that breed alone is not a reliable predictor of individual behavioural tendencies, including those related to aggression, and therefore breed-specific legislation is unlikely to be an effective instrument for reducing risk."
Mit Coppinger & Feinstein (2015) gesagt: Gene liefern (allenfalls) ein Potenzial für ein Verhalten. Ob sich dieses Potenzial entfaltet oder nicht, hängt stark von Lernerfahrungen und der Umwelt ab.

Sehr oft begegnet mir im Training folgendes: Der Hund soll z. Bsp. bei Besuch ruhig (und entspannt / gelassen / zufrieden) auf seinem Platz liegen. Dafür wird er dann mittels Signal auf eben diesen Platz geschickt. Dort fiept und winselt der Hund aber dann, bellt teilweise sogar. Und, wenn's hoch kommt, kann der Hund das Signal nicht mehr halten.
Wir müssen uns bewusst sein: Wir können unsere Hunde nicht zur Ruhe zwingen. Denn Ruhe und Gelassenheit ist viel mehr als Signale. Es ist sozusagen ein innerer Zustand, bei dem nebst ausreichend Schlaf vieles Weiteres mitspielt: Selbstregulation der Erregungslage, Erwartungssicherheit, Bedürfnisbefriedigung, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz, Selbstwirksamkeit. Signale können uns dabei gegebenenfalls unterstützen: Sie helfen etwa bei der Erwartungssicherheit, als dass sie dem Hund etwa bei Unsicherheit zeigen können: "Das wäre ein Verhalten, dass dir dabei hilft, diese Unsicherheit zu überwinden". Oder aber sie können - wenn positiv trainiert - in einem gewissen Mass die Erregungslage regulieren (Signale können aber auch gegenteilig wirken!).
Ein weiterer Punkt, der im Hundetraining oftmals unterschätzt wird, ist Stimmungsübertragung. Was ein wenig nach Esoterik klingt, ist tatsächlich ein völlig normales, biologisches Prinzip, das bei einer Vielzahl von Tieren nachgewiesen wurde (etwa bei Wölfen, Vögel, mehreren Affenarten und selbst zwischen Mensch und Hund). Auch kann der sogenannte Pygmalion-Effekt eine Rolle spielen, der unter anderem bei Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern nachgewiesen wurde. Dieser Effekt tritt meines Erachtens auch im Hundetraining auf: Ich schicke meinen Hund auf seinen Platz, gehe aber schon davon aus, dass er nicht ruhig sein kann, weil er immer so überdreht und unruhig ist - entsprechend höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Hund dann genau so verhält.
Ruhe und Gelassenheit beim Hund ist also ein innerer Zustand, und nicht etwas, das wir nur mit Signalen (oder gar mit Hundeboxen oder Leinen) erzwingen können. Vielmehr ist es das Eingehen von uns auf die Bedürfnisse, den Charakter, die Individualität unserer Hunde von grosser Wichtigkeit.

Zwar sorgt Auspowern - wie im letzten Beitrag geschrieben - nicht für ruhige und vor allem gelassene Hunde, allerdings ist der ursprüngliche Gedanke dahinter tatsächlich wichtig: Dass Hunde genügend Schlaf benötigen. Denn Hunde schlafen viel mehr pro Tag als wir, ca. 14 bis 16 Stunden. Dazu kommen weitere 4-6 Stunden "ruhendes Wachliegen" und "dösen" (u.a. Schork et al, 2022). Das heisst: Im Optimalfall ruht und schläft ein Hund 18 bis 20 Stunden pro Tag.
Schlafmangel zieht eine ganze Menge von Nebeneffekten nach sich, die durchaus gewichtig sind: Nebst einem erhöhten Stress-Level sind dies etwa ein erhöhtes Schmerzempfinden, verringerte kognitive und physische Leistungsfähigkeit sowie ein beeinträchtigtes Immunsystem (Mondino et al, 2021). Zudem kann ein zu geringes Schlafpensum eine Reihe von Verhaltensauffälligkeiten verursachen, einschliesslich erhöhte Ängstlichkeit, Trennungsangst oder Aggressionsverhalten gegen Menschen als auch Artgenossen (Tooley & Heath, 2022). Im Verhaltenstraining gilt Schlafmangel, nebst Schmerz sowie Angst, als einer der häufigsten Auslöser für Aggressionsverhalten (Blaschke-Berthold, 2019).
Hunde schlafen dabei am liebsten in der Nähe ihrer Menschen, meist sogar im selben Raum. Hunde, die bereits gewisse Verhaltensauffälligkeiten zeigen, fällt es schwer zu schlafen bzw. zu ruhen, wenn ihr Mensch aktiv ist (Kinsman et al, 2019). Jüngere Hunde (bis 12 Monate), ältere sowie kranke Hunde benötigen in der Regel mehr Schlaf als andere Hunde (Owczarczak-Garstecka & Burman, 2016). Dabei sind gerade die Schlafphasen für Lernprozesse eminent wichtig: Während des Schlafs werden neue Verhaltensweisen memorisiert (Kis et al, 2017), die Leistungsfähigkeit - physisch wie psychisch - wird wieder hergestellt und einiges deutet daraufhin, als dass "neurotoxische Abfallprodukte, die sich im Gehirn angesammelt haben, bereinigt werden" (Mondino et al, 2021).
Schlafen ist für Hunde, wie auch für uns Menschen, also einer der wichtigsten Aspekte für einen ruhigen und gelassenen Hund. Wir Hundemenschen tun gut daran, dafür zu sorgen, als dass unsere Hunde optimale Bedingungen vorfinden, um ihren (gerechten) Schlaf auch zu erhalten.